Ich bin jemand, der funktioniert. Ich kann viel leisten, organisieren, durchhalten – beruflich wie privat. Und ich bin gut darin.
Gleichzeitig habe ich unglaublich viel Energie. Ich liebe es, tausend Dinge gleichzeitig zu machen, Neues auszuprobieren und mich voll reinzuhängen. Doch genau das macht es oft herausfordernd, die Balance zu halten – zwischen zu viel und zu wenig für mich selbst.
Manchmal spüre ich dann: Ich laufe innerlich leer.
Es ist nichts Lautes – einfach ein Moment, in dem ich spüre, dass etwas fehlt.
In diesen Momenten frage ich mich: War’s das? Soll mein Leben so weitergehen? Oder gibt es da noch mehr – von mir, für mich?
Diese Fragen bringen mich immer wieder dazu, tiefer hinzuschauen. Ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, lese Bücher, höre Podcasts, reflektiere – und stoße dabei immer wieder auf einen Begriff, der in mir viel bewegt: Resilienz.
"Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln."
Dalai Lama
Was Resilienz bedeutet – mehr als nur Widerstandskraft
Der Begriff Resilienz geht auf das lateinische Wort „resilire“ zurück – es bedeutet „zurückspringen“ oder „abprallen“. Genau darum geht es in der psychologischen Definition: Manche Menschen scheinen Schicksalsschläge, widrigste Lebensbedingungen oder sogar Traumata besser zu verkraften. An ihnen „prallt“ das Leben nicht spurlos ab, aber sie finden Wege, schneller wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ein Synonym für Resilienz ist daher oft „psychische Widerstandskraft“ oder „innere Stärke“.
Die Resilienz-Forschung nahm in den 1950er-Jahren ihren Anfang. Heute beschäftigen sich viele Disziplinen – Psychologie, Soziologie oder auch Pädagogik – damit, welche Faktoren unsere seelische Widerstandsfähigkeit beeinflussen. Denn Resilienz bedeutet, Krisen zu bewältigen, Traumata zu verarbeiten und Belastungen so ins Leben zu integrieren, dass wir gesund bleiben. Oft wird Resilienz deshalb auch als eine Art Immunsystem der Psyche bezeichnet. Das Gegenteil von Resilienz ist die sogenannte Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit eines Menschen.
Doch Resilienz ist kein starres Schutzschild. Sie ist die Fähigkeit, mit dem Leben mitzugehen, ohne sich selbst zu verlieren. Es geht nicht darum, dass dich nichts mehr trifft – sondern darum, wie du wieder aufstehst. Mit Klarheit. Mit Selbstempathie. Mit innerer Beweglichkeit.
Resiliente Menschen sind nicht automatisch „stark“ im äußeren Sinne. Aber sie sind verbunden mit sich selbst – und können dadurch besser mit Unsicherheiten umgehen.
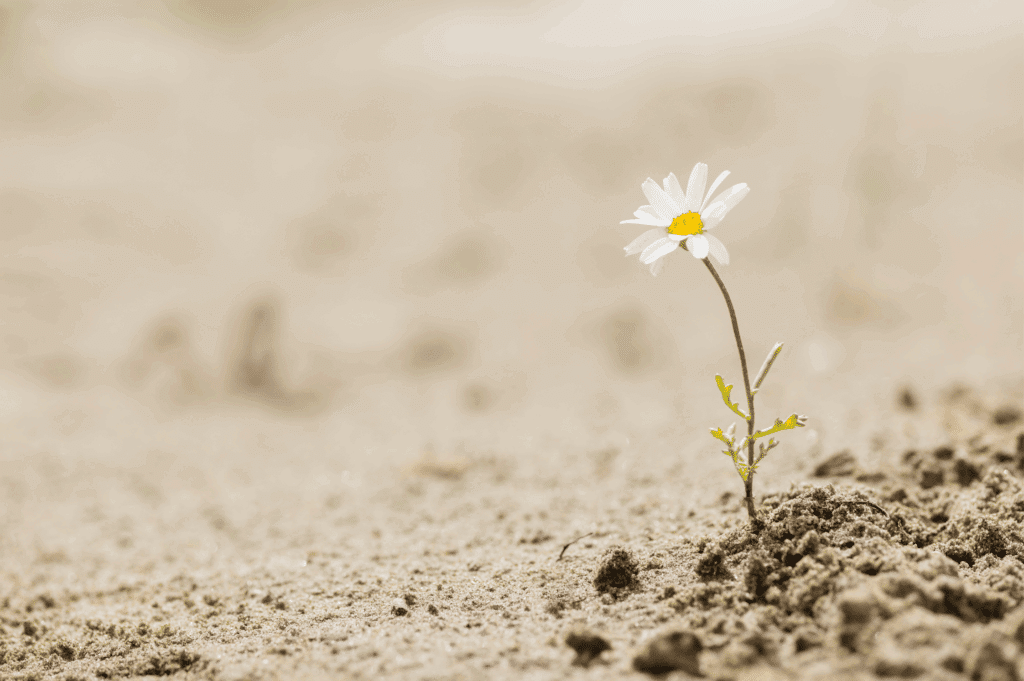
Die 7 Säulen der Resilienz – dein mentales Fundament
Was sind die 7 Säulen der Resilienz – und wie heißen sie genau? Die Psychologin Jutta Heller beschreibt Resilienz als eine innere Haltung, die sich stärken lässt. Ihr Modell zeigt, welche Faktoren dabei entscheidend sind. Die 7 Säulen der Resilienz sind:
1. Optimismus
Vertrauen darauf, dass es wieder hell wird
2. Akzeptanz
Annehmen, was ist, statt dagegen anzukämpfen
3. Lösungsorientierung
Den Blick aktiv nach vorne richten
4. Selbstwirksamkeit
Spüren: Ich kann etwas beeinflussen
5. Verantwortung übernehmen
Nicht Schuld, sondern Gestaltung
6. Netzwerkorientierung
Verbindung statt Rückzug
7. Zukunftsplanung
Ziele geben Richtung und Sinn
Diese Säulen bilden das Fundament, um innere Stärke zu entwickeln und Krisen besser zu bewältigen. Wer verstehen möchte, was Resilienz genau bedeutet, findet hier eine klare Orientierung.
📚 Vertiefung: „7 Schlüssel für mehr innere Stärke“ von Jutta Heller
Was schwächt – und was stärkt deine Resilienz?
Nicht jeder Tag fühlt sich gleich an. Manche schwächen. Andere geben Kraft. Je bewusster wir unsere Einflussfaktoren kennen, desto gezielter können wir Resilienz im Alltag aufbauen.
Typische Resilienz-Killer:
- Dauerstress ohne Erholungsphasen
- Grübeln & Gedankenkreisen
- Perfektionismus & Selbstkritik
- Isolation oder sozialer Rückzug
- Vergleich mit vermeintlich „stärkeren“ Menschen
Faktoren, die Resilienz fördern:
- Selbstfürsorge, die über „Wellness“ hinausgeht
- Klare Routinen, die Sicherheit geben
- Gespräche, in denen du echt sein darfst
- Bewegung, die dich nicht optimiert – sondern stabilisiert
- Reflexion & Journaling
Resilienztraining ist also kein starres Konzept, sondern ein Übungsfeld. Spannend ist die Frage: Wie lässt es sich im Alltag leben?

Was ist Resilienztraining – und was bedeutet es genau?
Resilienztraining ist keine Wunderlösung, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Oft beginnt er leise, entfaltet aber eine tiefgreifende Wirkung. Ziel ist es, die eigene seelische Widerstandsfähigkeit zu stärken und einen gesunden Umgang mit Belastungen zu entwickeln.
Was Resilienztraining beinhaltet:
- Gedankentraining: Eigene Muster erkennen und bewusst umlenken
- Emotionsarbeit: Gefühle zulassen, ohne von ihnen überrollt zu werden
- Körperbewusstsein: Frühzeitig spüren, wann Spannung entsteht
- Zielklärung: Herausfinden, was wirklich wichtig ist
- Entspannung: Nicht nur reagieren, sondern aktiv Strategien aufbauen
- Innere Dialoge verändern: Mit sich selbst klar und freundlich sprechen
Was Resilienztraining nicht ist:
- Kein „höher-schneller-weiter“-Tool
- Kein Positivitätsdogma oder ständiges „Alles ist gut“
- Kein Ersatz für Therapie
- Kein Versprechen, dass Probleme verschwinden
- Kein geradliniger Weg – sondern ein Übungsfeld, das sich mit jedem Schritt verändert
Kurz erklärt: Resilienztraining hilft nicht, Probleme auszublenden, sondern dabei, einen stärkeren Umgang mit ihnen zu entwickeln.
Was schwächt – und was stärkt deine Resilienz?
Nicht jeder Tag fühlt sich gleich an. Manche schwächen. Andere geben Kraft. Je bewusster wir unsere Einflussfaktoren kennen, desto gezielter können wir Resilienz im Alltag aufbauen.
Typische Resilienz-Killer:
- Dauerstress ohne Erholungsphasen
- Perfektionismus & Selbstkritik
- Isolation oder sozialer Rückzug
- Vergleich mit vermeintlich „stärkeren“ Menschen
Faktoren, die Resilienz fördern:
- Selbstfürsorge, die über „Wellness“ hinausgeht
- Klare Routinen, die Sicherheit geben
- Gespräche, in denen du echt sein darfst
- Bewegung, die stabilisiert
- Reflexion & Journaling

3 Mini-Impulse für deinen Alltag
Diese Übungen ersetzen keine innere Arbeit – sie sind ein Einstieg in die Verbindung mit dir:
- Die 3-Minuten-Pause
Setze dich aufrecht hin. Atme tief. Spüre deinen Körper.
Frage dich: Was brauche ich jetzt – nicht morgen, nicht irgendwann – jetzt? - Perspektivwechsel
Wenn du feststeckst, frage dich: Was würde ich einer guten Freundin raten, wenn sie in meiner Situation wäre? - Abendreflexion
Nimm dir 2 Minuten: Was habe ich heute gut gemacht – ganz egal, wie klein es war?
Wenn du deine Resilienz stärken möchtest, melde dich gerne bei mir. Meine Workshops bieten dir praktische Impulse und nachhaltige Strategien – schau dir hier die aktuellen Termine an.